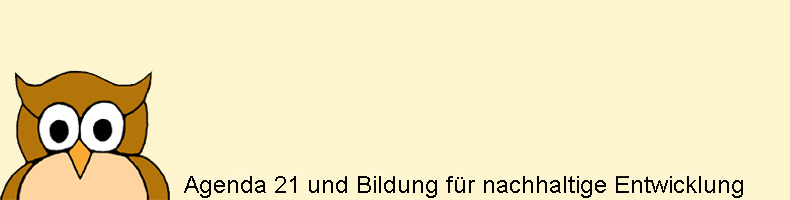Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee
Gliederung dieser Seite |
Hier sollen wesentliche Aspekte der Nachaltigkeitsidee systematisiert und auch kritisch hinterfragt werden. In der Struktur sowie in einigen wesentlichen Argumentationslinien orientiere ich mich dabei an Fischer (1997, S. 27ff und 2000). Er bezeichnet die hier angesprochenen Merkmale als „Kristallisationspunkte, die gemeinsam zur Nachhaltigkeitsidee verschmelzen“ (Fischer 2000).
Inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit
Die Nachhaltigkeits-Definition des Brundtlandberichtes zielt unmittelbar auf Gerechtigkeit zwischen heutigen und künftigen Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit). Auch die Agenda 21 ist diesem Ziel verpflichtet. Sowohl der Brundtlandbericht als auch die Agenda 21 fordern jedoch auf einer zweiten Ebene auch Gerechtigkeit zwischen den gleichzeitig lebenden Menschen (intragenerationelle Gerechtigkeit) ein, und zwar sowohl in der globalen Dimension (Norden – Süden, entwickelte Länder – Entwicklungsländer) als auch innerhalb jeder Gesellschaft (dort z.B. zwischen Arm und Reich sowie zwischen den Geschlechtern).
Gerechtigkeit ist dabei einerseits ein Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, andererseits auch deren Voraussetzung, denn die ungerechte Verteilung des Zugangs zu knappen Ressourcen (z.B. Boden, Trinkwasser) ist auch die Ursache von nicht nachhaltigen Entwicklungen: von gesellschaftlichen und sozialen Konflikten oder einer verschärften Ausbeutung der Umwelt (Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 30).
So plausibel und unterstützenswert die Forderung nach Gerechtigkeit auch ist, so schwierig ist die für politisches Handeln notwendige Operationalisierung. Was kann überhaupt unter Gerechtigkeit verstanden werden, welcher der oben genannten Ebenen bzw. Dimensionen ist welches Gewicht beizumessen und wie können geeignete Maßstäbe entwickelt werden?
Fischer (1997, S. 39ff) weist darauf hin, dass in der Agenda 21 und im Nachhaltigkeitsdiskurs überwiegend Verteilungsgerechtigkeit gefordert werde; mit Rückgriff auf Huber (1995) betont er, dass diese in verschiedenen Varianten – so als Bedürfnisgerechtigkeit, als Leistungsgerechtigkeit oder als Besitzstandsgerechtigkeit – ausgebildet werden könnte. Schicha spricht hingegen von Chancengleichheit. „Der normative Gehalt dieser Forderungen liegt in dem Postulat der „Chancengleichheit". Gefordert wird die Solidarität zwischen dem Norden und dem Süden. Der Wohlstand für alle stellt ein Hauptmerkmal der nachhaltigen Zielsetzung dar. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass die Entwicklungsländer den gleichen Lebensstandard wie die Industrieländer erreichen sollten, da die sozialen und ökologischen Folgen aufgrund des übermäßigen Naturverbrauchs bereits heute die Grenzen nachhaltigen Wirtschaftens bei weitem überschritten haben. Das primäre Ziel liegt zunächst in der Befriedigung der Grundbedürfnisse." Somit geht es zunächst darum, dass alle Menschen gleiche (vergleichbare) Chancen bekommen, ihr Leben menschenwürdig und selbstbestimmt zu gestalten. Perspektivisch ist zu klären, welcher Lebensstandard dauerhaft tragfähig ist.
In der Frage nach der Bezugsebene verweist Fischer (1997, S. 39ff) auf die Probleme beim Versuch, intergenerationelle Gerechtigkeit zu operationalisieren. Demnach hat z.B. in den letzten 300 Jahren nahezu jede Generation insgesamt bessere Lebensbedingungen angetroffen bzw. sich schaffen können als die Generation ihrer Eltern. Dazu gehören nicht nur der Lebensstandard sondern auch der Stand von Wissenschaft und Technik und damit die Möglichkeiten, die begrenzten Ressourcen zu nutzen. Für drängender hält er daher einen Gegenwartsbezug, d.h. die Konzentration auf die intragenerationelle Gerechtigkeit.
BUND/MISEREOR (1995, S.7) hingegen halten beide Bezugsebenen für gleichermaßen relevant, sie konzentrieren sich dabei auf die globale Dimension, also die weltweit gerechte Verteilung der verfügbaren Ressourcen (des Umweltraumes).
Die Bundesregierung (2002) spricht in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie alle oben genannten Bezugsebenen an. Als Beitrag zur Generationengerechtigkeit versteht sie u.a. die Ressourcenschonung, den Schutz der Artenvielfalt, den Abbau der Staatsverschuldung und die Bildung. Mit Blick auf die heutige Generation sollen die Lebensqualität gesteigert (u.a. durch wirtschaftlichen Wohlstand und Gesundheit) und der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden (u.a. mit Aspekten wie Beschäftigung, Gleichberechtigung und Integration ausländischer Mitbürger). Zudem will die Bundesregierung auch global Verantwortung übernehmen, z.B. für die Bekämpfung der Armut oder den weltweiten Umweltschutz.
Die Heinrich-Böll-Stiftung (2002, S. 20) verweist dezidiert darauf, dass die in der Gerechtigkeitsfrage weithin gebräuchliche Unterscheidung zwischen „Nord“ und „Süd“ in die Irre führe: Die entscheidende Trennungslinie in dieser Welt verlaufe hingegen quer zu jeder Gesellschaft zwischen den globalen Reichen und den lokalen Armen. An dieser Stelle setzt auch die fundamentale Kritik an, die z.B. Spehr (1996) und Eblinghaus/Stickler (1998) am Diskurs um die Nachhaltigkeit üben. Sie sehen die Machtfrage – also die Frage nach Staats- und Gesellschaftsformen, Besitz- und Herrschaftsverhältnissen – als Schlüsselfrage zu den Problemlagen der Welt an; daher greift das Nachhaltigkeitsleitbild aus ihrer Sicht zu kurz, bzw. es ist sogar kontraproduktiv, weil es diese Frage verschleiert.
Die Frage, welche Größen geeignet sind und Gerechtigkeit zu bemessen, kann hier nur angerissen werden. BUND/MISEREOR kamen zu dem Schluss, dass die Bundesrepublik Deutschland 5-10 mal soviel Umweltraum verbraucht wie ihr bei einer weltweit gerechten und dabei ökologisch tragfähigen Verteilung zustehen würde (vgl. Studie Zukunftsfähiges Deutschland).
Ethisch-moralische Fundierung
Das Postulat der Gerechtigkeit verweist bereits auf ein zweites Merkmal der Nachhaltigkeitsidee: ihre ethisch-moralische Fundierung. Gerechtigkeit oder die Verantwortung für die Umwelt oder für andere Menschen lassen sich nicht naturwissenschaftlich und auch kaum ökonomisch begründen, sondern nur auf der Basis von Werte-Entscheidungen. Dabei sind die ethischen Verpflichtungen auf der abstrakten Ebene (z.B. Verantwortung gegenüber künftigen Generationen) noch einigermaßen konsensfähig – komplizierter wird es im Detail, so etwa wenn diese Verpflichtungen begründet oder konkretisiert werden sollen. Das soll nachfolgend in einer sehr starken Verkürzung für den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit skizziert werden.
Umweltethische Grundpositionen
Grundsätzlich können im Mensch-Umwelt-Verhältnis zwei ethische Grundpositionen unterschieden werden:
- Aus der physiozentrischen Perspektive ist der Natur prinzipiell ein Eigenwert zuzuschreiben; sie muss daher um ihrer selbst willen geachtet und geschützt werden. Aus dieser Perspektive kritisiert z.B. Piechocki (2001) grundsätzlich das in der heutigen Zeit vorherrschende instrumentelle Bild von der Natur (Umwelt), bei dem der Mensch die Natur ganz überwiegend als Ressource ansieht, über die er nach Belieben verfügen kann. Er plädiert statt dessen für ein Verständnis von Mit-Welt. Der SRU (1994, S. 53) hingegen sieht diese Perspektive als problematisch an.
- Aus der anthropozentrischen Perspektive hat die Natur keinen moralischen Eigenwert, wohl aber kann der Mensch ihr Wert zuweisen. Natur- bzw. Umweltschutz wird damit nicht ausgeschlossen, aber er ist alleine aus einem Eigeninteresse der Menschen (Erhalt und Sicherung der für das menschliche Leben benötigten Ressourcen, Erfüllung weiterer menschlicher Bedürfnisse) heraus motiviert. Der SRU spricht sich klar gegen die Vorstellung aus, eine anthropozentrische Ethik müsse zwangsläufig zu einer Desensibilisierung gegenüber den anderen Lebewesen führen. Nach Conrad (2000) und nach Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 21) basiert das Leitbild der Nachhaltigkeit eindeutig auf einer anthopozentrischen Ethik; der behutsame Umgang mit der Natur entspringt hier einem wohlverstandenen Eigeninteresse der Menschen.
Derartige ethische Fragen können bspw. im Sozialkunde-, Religions- oder Philosophieunterricht thematisiert werden.
Schwache vs. starke Nachhaltigkeit
Hier soll noch eine andere ethische Frage zumindest angerissen werden; für eine vertiefende Betrachtung wird auf SRU (2002, S. 57-68) verwiesen. Wenn wir künftigen Generationen die gleichen Chancen einräumen wollen wie wir sie haben, so ist zu fragen, woraus sich unsere Hinterlassenschaften an sie zusammensetzen, wie diese Bestandteile der Hinterlassenschaften zu bewerten sind und welche Handlungsmaximen sich daraus ableiten lassen. Der SRU (2002, S. 59) unterscheidet folgende Formen von „Kapital“:
- Sachkapital (z.B. Infrastruktur)
- Naturkapital (z.B. Grundwasser, Tier- und Pflanzenarten)
- kultiviertes Naturkapital (z.B. Vieherden, Lachsfarmen, Forste)
- Sozialkapital (moralisches Orientierungswissen, Institutionen)
- Humankapital (Bildung, Fähigkeiten) und
- gespeichertes und abrufbares Wissenskapital (Bibliotheken, Internet).
Wie sollte dieses Kapital bewirtschaftet und vererbt werden? Im Sinne der Gerechtigkeit sollte den nachfolgenden Generationen mindestens ein gleichwertiger Kapitalbestand vererbt werden, wie wir (die heutige Generation) ihn nutzen. Angesichts dessen können zwei verschiedene Konzepte ausgemacht werden (vgl. bspw. Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 37-39):
- Nach dem Konzept der schwachen Nachhaltigkeit kommt es vor allem darauf an, den Gesamtbestand des Kapitals zu erhalten. Demnach ist es zulässig, Naturkapital (z.B. nicht erneuerbare Energieträger) zu verbrauchen, wenn dafür Ersatz (z.B. in Form von Know-How, Technologien und Infrastruktur zur Nutzung erneuerbarer Energieträger) geschaffen wird. Bestimmte Kapitalformen können damit also durch andere substituiert werden.
- Nach dem Konzept der starken Nachhaltigkeit ist die Substitution nur sehr eingeschränkt möglich. Insbesondere Naturkapital gilt hier als nicht substituierbar. Diese Position leuchtet auch aus naturwissenschaftlicher Sicht ein, wenn man „Natur“ nicht nur eindimensional als Ressource betrachtet. Angesichts der vielfältigen Elemente in einem Ökosystem und der komplexen Wechselwirkungen zwischen ihnen ist zu bezweifeln, ob eine Vermehrung anderer Kapitalformen die Verluste ausgleichen kann, die das Aussterben von Arten, die Devastierung von Böden oder die Veränderung des Klimas bedeuten. Der Klimaexperte Andrew Dlugolecki warnt „davor, dass die Vernichtung von Nettovermögen in einer Welt, die nichts gegen den Ausstoß von Treibhausgasen unternimmt, ungefähr ab dem Jahr 2065 größer sein wird als die Schaffung von Nettovermögen.“ - d.h. er sieht den Gesamtbestand des Kapitals in Gefahr, wenn nicht jeder einzelnen Kapitalform die nötige Aufmerksamkeit gewidmet wird (Leggett 2006, S. 153). Nach dem Konzept der starken Nachhaltigkeit sollte jede Generation nicht nur den Gesamtbestand an Kapital sichern, sondern auch die einzelnen Formen. Der SRU (2002, S. 68) spricht sich für die starke Nachhaltigkeit aus.
Grunwald/Kopfmüller (2006) halten beide Konzeptionen als Extrempositionen für wenig praktikabel, eine strikt durchgesetzte starke Nachhaltigkeit würde ansonsten zu dem Paradoxon führen, dass das vorhandene Naturkapital an nicht erneuerbaren Ressourcen gar nicht genutzt werden düfte. Sie plädieren für eine mittlere Position, wobei eine begrenzte Substitution von Naturkapital durch z.B. Sozial- oder Humankapital zulässig sein soll, sofern dabei die grundlegenden Naturfunktionen erhalten bleiben.
Retinität (Gesamtvernetzung)
Einzelentscheidungen des Menschen (z.B. in der Politik, in der Wirtschaft, Kaufentscheidung eines Verbrauchers) sind in ein komplexes Netzwerk von Ursachen und Wirkungen eingebunden, die sowohl die menschlichen Zivilisationssysteme als auch die Ökosysteme betreffen. Der SRU (1994 S. 54-55) führt die Vokabel der Gesamtvernetzung oder Retinität (lat. rete – das Netz) ein, und sieht darin „die entscheidende umweltethische Bestimmungsgröße und damit das Kernstück einer umfassenden Umweltethik... Will der Mensch seine personale Würde im Umgang mit sich selbst und anderen wahren“ (und sich daher in seiner Ethik von der Natur abgrenzen, siehe anthropozentrische Perspektive), „so kann er der darin implizierten Verantwortung für die Natur nur gerecht werden, wenn er die ´Gesamtvernetzung´ all seiner zivilisatorischen Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur zum Prinzip seines Handelns macht.“ In anderen Worten: Der Mensch ist einzigartig, und dieser Einzigartigkeit sowie der Gesamtvernetzung seiner Handlungen entspringt auch seine Verantwortung gegenüber der Natur.
Das Sustainability-Konzept ist die „notwendige und konsequente Operationalisierung des Retinitätsprinzips“ (SRU 1994, S. 9).
In verschiedenen Nachhaltigkeitskonzeptionen wurde auf verschiedene Weise versucht, diese Gesamtvernetzung zu strukturieren und sie damit fassbarer zu machen (Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 37-58):
Ein-Säulen-Konzepte
Ein-Säulen-Konzepte räumen der Ökologie den Vorrang ein. Der SRU (2002, S. 67-68) vertritt ein derartiges ökologischen Verständnis von Nachhaltigkeit und sieht die notwendige Integration des Umweltschutzes in alle Politikbereiche für zentral an (vgl. auch SRU 2002, S. 167, wo Aktivitäten der Bundesregierung zur Integration des Umweltschutzes in die Ressorts/Bereiche Energie, Landwirtschaft, Verkehr, Bau, Entwicklungszusammenarbeit, Finanzen, Forschung, Gesundheit und Sozialpolitik aufgelistet und als Erfolg bewertet werden). BUND/MISEREOR (1996) beziehen sich in ihrer Studie Zukunftsfähiges Deutschland ausdrücklich auf das Gerechtigkeitspostulat, rücken dann aber das Konzept des Umweltraums in dem Mittelpunkt ihrer Studie, um Umweltindikatoren aufzustellen und Umweltziele festzulegen. Auch der Syndromansatz des WGBU kann als ein Versuch gewertet werden, die Gesamtvernetzung mit dem Focus auf ökologische Nachhaltigkeit zu ordnen.
Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 46) führen zwei zentrale Argumente gegen Ein-Säulen-Konzepte an:
- So erforderten die Umsetzung des Gerechtigkeitspostulats und die Übernahme von Verantwortung es prinzipiell, alle Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung - und nicht nur die ökologische - einzubeziehen.
- Ferner könne die ethische Frage, auf welche Hinterlassenschaften künftige Generationen einen Anspruch haben (zu vermeidende Risiken eingeschlossen), sich nicht alleine ökologisch beantworten lassen.
Drei-Säulen-Konzepte
Drei-Säulen-Konzepte sind eine folgerichtige Antwort auf derartige Kritik. Die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ hat ein Modell propagiert, welches Ökologisches, Ökonomisches und Soziales als gleichwertige Säulen vereint (Deutscher Bundestag 1998). In einer anderen Darstellung – als „Nachhaltigkeitsdreieck“ – hat sich dieses als eines der bekanntesten mentalen Modelle im Nachhaltigkeitsdiskurs etabliert (vgl. Abbildung); auch z.B. die Erklärung von Johannesburg (Vereinte Nationen 2002, S.1) nimmt auf diese drei Säulen Bezug.
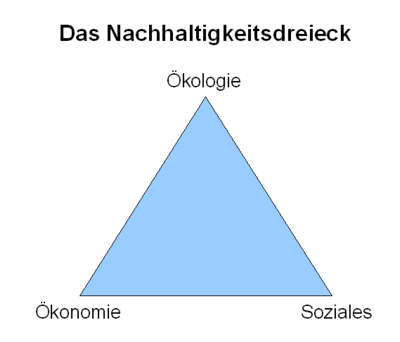
Teilweise wird dieses Dreieck um eine vierte „Dimension“ (z.B. Kulturelles oder – bei VENRO 2005, S. 4 – um die politische Stabilität, d.h. Frieden, Menschenrechte, Demokratie und Gleichberechtigung) erweitert. Auch für die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Schule kann ein solches vierdiemensionales Modell hilfreich sein.
de Haan/Harenberg (1999) halten eine solche vierte Dimension nicht für sinnvoll. Als globale Dimension gedacht, wäre sie nämlich bereits in den anderen Dimensionen enthalten – denn diese beschreiben überwiegend globale Herausforderungen. Kulturelles – hier verstanden als die kulturell bedingte Sichtweisen auf ökologische, ökonomische oder soziale Fragen – wäre demnach ebenfalls keine eigene Dimension sondern Bestandteil der Reflexion zu den anderen Dimensionen.
Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 52-53) verweisen auf Probleme dieser Modelle.
- Einerseits werde von Kritikern eine Überfrachtung des Nachhaltigkeitsleitbildes befürchtet – mit der Tendenz, zu einem Ein-Säulen-Konzept zurückzukehren.
- Andererseits verleiteten die Drei-Säulen-Modelle dazu, anzunehmen, der Nachhaltigkeitsbegriff könne isoliert auf die Teilbereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales angewendet werden, bzw. diese drei Bereiche könnten / müssten evtl. doch auch gegeneinander verhandelt werden.
Integrative Nachhaltigkeitskonzepte
Integrative Nachhaltigkeitskonzepte versuchen, insbesondere den zweiten Kritikpunkt zu überwinden. Sie gehen davon aus, „dass die der Nachhaltigkeitsidee zugrunde liegenden normativen Prämissen Zukunftsverantwortung und Verteilungsgerechtigkeit dimensionenübergreifend angelegt sind.“ (Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 53) Zudem gibt es vielfältige Verflechtungen zwischen der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Dimensionen, weshalb diese nicht isoliert betrachtet werden sollten (ebd.).
Die Bundesregierung (2002) folgt offenbar derartigen Überlegungen und gliedert im Nationalen Nachhaltigkeitskonzept ihre Aktivitäten in vier „quer“ zu traditionellen politischen Ressorts zugeschnittene Themenfelder:
- Generationengerechtigkeit,
- Lebensqualität,
- sozialer Zusammenhalt,
- Internationale Verantwortung.
Wie weit das die nachhaltige Entwicklung befördert und die Wahrnehmung des Nachhaltigkeitsleitbildes verbessert, bleibt abzuwarten.
Ökonomisch-ökologische Neuorientierung
Eine nachhaltige Entwicklung ist nicht ohne eine ökonomisch-ökologische Neuorientierung denkbar. „Die Zukunft der Menschheit wird davon abhängen, ob es gelingt, zu einer Wirtschaftsweise zu gelangen, die sich innerhalb der Nutzungsgrenzen des Naturhaushalts bewegt und dennoch allen Menschen ein lebenswertes Dasein ermöglicht.“ (ICLEI 1998 S. 18)
Fischer (2000) spricht von einem neuen Verständnis des Wirtschaftens, „das sich vom traditionellen wirtschaftlichen Fortschritts- und Wachstumsmodell loslöst.“
Conrad (2000 S. 2-3) sieht in der nachhaltigen Entwicklung keinen vollständigen gesellschaftlichen Umbruch, sondern eher ein Korrektiv; für ihn ist Nachhaltigkeit der „Idealtypus moderner Industriegesellschaft..., ökologisch modernisierte Moderne.“
Dieses neue Verständnis findet seinen Ausdruck u.a. in den Managementregeln, wie sie in Deutschland im Konzept Nachhaltigkeit bzw. der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt wurden.
Neben diesen Managementregeln sollen verschiedene (einander ergänzende) Strategien als Leitplanken für diese ökonomisch-ökologische Neuorientierung dienen:
- Die Effizienzstrategie zielt
darauf, die erwünschten Produkte bzw. Dienstleistungen
mit einem möglichst geringen Material- und Energieeinsatz
zu erzeugen, bzw. – andersherum gedacht – den
Wirkungsgrad des Material- und Energieeinsatzes zu
erhöhen. Weizsäcker/Lovins/Lovins (1996) halten eine Erhöhung der Energieeffizienz um den
Faktor Vier für erforderlich und auch für
machbar. Schmidt-Bleek (1993, 1998,
2000) fordert entsprechend
eine Erhöhung der Materialeffizienz um den Faktor
10.
Mit MIPS (Schmidt-Bleek 1993 und 1998), dem ökologischen Rucksack und dem ökologischen Fußabdruck sind dabei Denkmodelle entstanden, welche die Bildung für nachhaltige Entwicklung didaktisch bereichern (Begriffserklärungen im nachfolgenden Exkurs).
In Bildungsprojekten wie fifty/fifty (Klimabündnis 2005; vgl. auch finanzielle Anreizsysteme zum sparsamen Umgang mit Ressourcen), dem Öko-Audit oder dem Nachhaltigkeitsaudit verbessern Schüler die Effizienz des Schulbetriebes. - Einerseits warten weltweit noch erhebliche Effizienzreserven darauf, erschlossen zu werden; andererseits besteht die Gefahr, dass Effizienzgewinne durch eine Steigerung des Wohlstandes oder ein Wachstum der Bevölkerung wieder „aufgefressen“ werden. Die Suffizienzstrategie setzt hier an, sie steht für einen Lebensstil der Bescheidenheit und Selbstbegrenzung. Es verspricht selbst in einem reichen Land wie Deutschland wenig Erfolg, unverblümt für eine Askese zu werben. BUND/MISEREOR (1995 und 1996) haben daher versucht, Suffizienz mit positiven Leitbildern wie „Gut leben statt viel haben“ zu verbinden.
- Die Konsistenzstrategie schließlich nimmt qualitative Aspekte des Umweltverbrauchs in den Focus. Die vom Menschen in Gang gesetzten Stoff- und Energieströme sollen sich danach an den Qualitäten der Naturkreisläufe orientieren. Hierzu gehört auch die Substitution, also der Austausch umweltschädlicher gegen umweltfreundliche Stoffe.
Ein neues Verständnis des Wirtschaftens muss einerseits durch einen Wertewandel eingeleitet werden, andererseits muss diese Neuorientierung, sofern sie nicht die Angelegenheit weniger Idealisten bleiben soll, durch eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen flankiert werden, z.B. durch Ökosteuern.
Strittig ist, wie weit diese Neuorientierung gehen muss. Piechocki (2001) vertritt eine recht weitgehende Position, er kritisiert den der Marktwirtschaft in ihrer heutigen Ausprägung innewohnenden Zwang zum Wirtschaftswachstum als eine der zentralen Ursachen für die Naturzerstörung. Die Heinrich-Böll-Stiftung (2002, S. 15) vertritt eine ähnliche Position und kritisiert: "Rio versäumte, sich von ´Entwicklung als Wachstum´ loszusagen.“
Exkurs: Denkmodelle der Effizienzstrategie
Die Vordenker der Effizienzstrategie haben Denkmodelle entwickelt, die einerseits dazu beitragen, Effizienz zu messen und andererseits, sie zu kommunizieren. Damit wurden (aus unserer Bildungs-Perspektive) didaktische Bausteine geschaffen, die eine nähere Betrachtung verdienen.
MIPS = Material Input pro Serviceeinheit. Das Modell will den Ressourcenverbrauch für die Erfüllung bestimmter menschlicher Bedürfnisse quantifizieren und den Blick auf effizientere Alternativen zur Bedürfnisbefriedigung lenken. Dazu ein Beispiel: Legen Sie Wert darauf, einen Fernseher zu besitzen? Oder möchten Sie einfach nur (z.B.) einen Spielfilm sehen? Letzteres ließe sich z.B. auch realisieren, indem Sie einen Fernseher nicht kaufen sondern leasen (die Verantwortung für das Produkt und z.B. dessen Langlebigkeit bleibt beim Hersteller/Leasinggeber), indem Sie eine DVD an dem evtl. ebenfalls im Haushalt befindlichen PC abspielen, den Film aus dem Internet downloaden oder ins Kino gehen / fahren. Es entsteht somit ein ganzen Spektrum an Optionen, das Ihnen zur Erfüllung Ihres Bedürfnisses zur Verfügung steht. Sie können die Option auswählen, welche relativ (pro gesehenem Film) den geringsten Materialeinsatz erfordert. – Da wir Güter (mit Ausnahme sogenannter Verbrauchsgüter wie z.B. Nahrungsmittel) nutzen, um damit Dienstleistungen zu realisieren, können vergleichbare Überlegungen auch für diverse andere Bereiche angestellt werden, so z.B. auch für diesen Artikel, den Sie gerade lesen.
Der Begriff „ökologischer Rucksack“ wurde 1994 von Schmidt-Bleek entwickelt, um MIPS zu illustrieren. „Jede Tonne Steinkohle, die wir verfeuern, trägt einen Rucksack von 5 Tonnen Abraum und Wasser. Dazu kommen ca. 3,3 Tonnen Kohlendioxidemissionen, die im Verbrennungsprozess entstehen. Der ökologische Rucksack von Steinkohle ist also knapp 8,5-mal, der von Braunkohle sogar insgesamt zehnmal so schwer die Kohle selbst.“ (Lexikon der Nachhaltigkeit o.J.).
Der ökologische Fußabdruck beschreibt die Fläche, die eine Gesellschaft zur Versorgung mit Ressourcen und zur Entsorgung der Abfälle und Emissionen benötigt – also die Summe der Flächen für Bauland für Wohnungen, die Acker- und Weideflächen für Nahrung, Verkehrsflächen, etc. Diesen Wert kann man einerseits für die gesamte Weltbevölkerung errechnen und andererseits auf den einzelnen Menschen herunterrechnen. Je nach Lebensweise verändert sich die Größe des Ökologischen Fußabdruckes. „Hintergrund für diese Überlegungen ist die ökologische Tragfähigkeit der Erde: Wieviel Menschen können auf der zur Verfügung stehenden, bewohn- und bebaubaren Fläche der Erde leben? Wie viele Rohstoffe kann eine bestimmte Fläche dem Menschen liefern, und wie viele Abfälle aufnehmen, ohne dass Schäden an der Natur entstehen?“ (Wuppertal-Institut 2002)
Der Begriff Fifty/fifty steht für Projekte zum Energie-(Wasser-, Abfall-)sparen in Schulen, bei denen die Schulen einen fest vereinbarten Prozentsatz der somit eingesparten Bewirtschaftungskosten zur Verfügung gestellt bekommen.
Zukunftsorientierter und utopischer Charakter
Nachhaltigkeit ist zukunftsorientiert und zugleich utopisch. Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist eine Utopie, aber nicht im Sinn „illusorischer Sorglosigkeit“ sondern „als Ausdruck eines Aufbruchs in eine offensiv auf Gewinnung neuer Perspektiven ausgerichteten Zukunft" (Fischer 2000) – gerade auch angesichts der Einengung der Zukunftsoptionen durch ökonomische, ökologische und soziale Probleme.
In dem seit der Aufklärung vorherrschenden Fortschrittsdenken der Moderne war (ist) alles (oder fast alles) machbar und gestaltbar, Zukunft ist demnach in einem unendlichen Spektrum von Möglichkeiten gestaltbar. Andererseits war die Umweltdebatte eher von Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet und von einer Position, nach der die Zukunft angesichts von Ressourcenknappheit und irreversibler Umweltbelastung kaum noch Gestaltungsspielräume offen lässt. Zwischen diesen beiden Extrempositionen geht es im Nachhaltigkeitsdiskurs darum, innerhalb bestimmter Grenzen (Leitplanken) Gestaltungsspielräume zu eröffnen bzw. zu erhalten, damit auch künftige Generationen über ihr Leben selbst bestimmen können. (Fischer 2000)
Dieses Merkmal ist ein Grund dafür, warum Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht alleine mit der traditionellen Vermittlung vorgegebener Wissensbestände auskommt, sondern vielmehr Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln will, sich in einer – in bestimmten Grenzen – offenen Zukunft zurechtzufinden (vgl. Exkurs: Das menschliche Dilemma und Grenzen des Lernens auf der Seite zur Bildung für nachhaltige Entwicklung).
Globaler, universaler Ansatz
Die Migration von Menschen, und noch mehr von Kapital, Waren, Rohstoffen oder Schadstoffen nimmt globale Ausmaße an; dafür stehen die Stichworte Globalität bzw. Globalisierung.
Die Agenda 21 will die globalen Probleme des beginnenden 21. Jahrhunderts lösen, Nachhaltigkeit ist eine globale Herausforderung, was lokale und regionale Aktivitäten wie die Lokale Agenda 21 keinesfalls ausschließt.
Grunwald/Kopfmüller (2006, S. 36) fordern, Attribute wie nachhaltig ohne weitere Erläuterung nur für die globale Entwicklung zu verwenden. Auf regionaler oder z.B. auch lokaler Ebene können lediglich Beiträge zu dieser globalen Nachhaltigkeit geleistet werden; eine Region kann jedoch für sich nicht nachhaltig sein.
Fischer (1997, S. 46-51, mit Rückgriff auf Sachs 1994) weist auf Probleme dieses globalen Anspruchs hin. Er sieht die Gefahr, dass wir nur noch eine „Astronautenperspektive“ einnehmen, dass Diagramme statt Akteuren in den Mittelpunkt rücken, dass wir uns mit Kalkulationen aber nicht mit Ethik befassen und Stabilität statt Schönheit suchen.
Hier ist die Bildung herausgefordert, sinnvolle lokale Zugänge zu den globalen Aspekten der Nachhaltigkeit zu schaffen.
Kommunikative, prozessorientierte Ausrichtung
Nachhaltigkeit ist ein normatives Leitbild, das auf Werteurteilen basiert. Dem klassischen Ansatz politischer Steuerung würde es entsprechen, das Leitbild zu operationalisieren und "planmäßig" umzusetzen (siehe Operationalisierung). Ein solches Vorgehen entspricht einem substanziellen Nachhaltigkeitsverständnis. „Angesichts der Komplexität des Nachhaltigkeitsbegriffs und der Vielfalt ökologischer und sozioökonomischer Systeme bestehen jedoch Zweifel an einer so weitgehenden Konkretisierbarkeit.“ (Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 40) Einen konzeptionellen Ausweg bietet hier, die Nachhaltigkeit als regulative Idee im Sinne Kants zu verstehen. Damit haben Definitionen der Nachhaltigkeit nur einen vorläufigen und hypothetischen Charakter; Nachhaltigkeit wird zu einem „orientierenden Rahmen für einen langfristigen Such-, Erfahrungs- und Lernprozess.“ (ebd., vgl. auch Deutscher Bundestag 1998, S. 72)
Bei einem prozeduralen Nachhaltigkeitsverständnis steht hingegen von Anfang an der Weg im Vordergrund. Gefährdungseinschätzungen, Handlungsbedarfe und Maßnahmen würden demnach nicht in langfristiger Perspektive von oben vorgegeben, sondern „beim Laufen“ zwischen den Akteuren ausgehandelt bzw. selbstorganisiert umgesetzt (Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 40-41).
Weitgehend durchgesetzt hat sich das substanzielle Verständnis mit Nachhaltigkeit als regulativer Idee. Wenn die Agenda 21 der Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen einen Hauptabschnitt (Teil III) widmet, geht es daher nicht nur darum, diesen Gruppen Aufgaben bei der Umsetzung einer von oben vorgegebenen Politik zuzuweisen; vielmehr wird eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung gefordert und die Partizipation als grundlegendes Element der nachhaltigen Entwicklung angesehen (Bundesumweltministerium 1992, S. 217). Der Aspekt der Partizipation wird im Beitrag zu den Methoden einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wieder aufgegriffen.
Der Arbeitsbereich "Agenda 21 und Bildung für nachhaltige Entwicklung" auf umweltschulen.de entstand 2006-2014 in Kooperation mit dem Fernstudiengang Umwelt&Bildung der Universität Rostock; dem heutigen Fernstudiengang Bildung und Nachhaltigkeit.