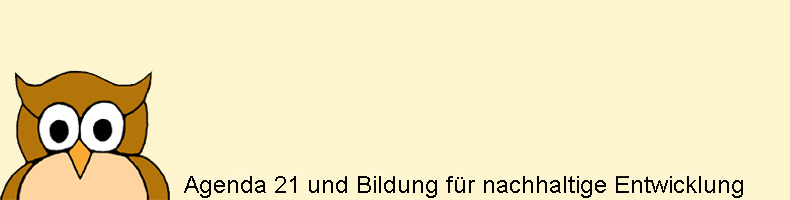Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee
Schon vor langen Zeiten haben Menschen über das Verhältnis von Mensch und Umwelt nachgedacht und ihr diesbezügliches Wissen gesammelt und weitergegeben.
Mensch-Umwelt-Beziehungen in Religionen
Bereits im Alten Testament (im 3. Buch Mose, Kapitel 11) finden sich Gesetzesvorschriften, die dazu dienen sollten, im alten Palästina eine schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen zu sichern und die biologischen Gleichgewichte aufrecht zu erhalten. So war die Schweinehaltung verboten, weil Schweine Nahrungskonkurrenten des Menschen sind. Wiederkäuer, welche vom Menschen nicht verwertbare Pflanzen fressen, durften hingegen gehalten und geschlachtet werden. Von den frei lebenden Tieren waren z.B. die Aasfresser, Greifvögel, Eulen und Störche geschützt, weil diese als Gesundheitspolizei oder als Fressfeinde der Nagetiere bzw. der Heuschrecken dem Menschen dienlich waren. (Kibbel/Müller 2002, S. 6 sowie Hüttermann 1997)
Opitz (1998) verweist darauf, dass es in allen großen Weltreligionen Empfehlungen bzw. Regelungen zum Schutz von Tieren und für eine (weitgehend) fleischlose Ernährung gegeben hat, was u.a. angesichts der enormen Energieverluste bei der „Umwandlung“ von pflanzlicher in tierische Nahrung auch heute einen sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Sicherung der Ernährung darstellen würde.
Dennoch sind die Religionen nicht die Hüterinnen der Nachhaltigkeit; auch sie haben sich in widerspruchsvollen Wegen entwickelt, und z.B. das Alte Testament als Sammlung von Texten verschiedener Autoren, die über mehrere Jahrhunderte hinweg entstanden sind und später weiter bearbeitet wurden, enthält auch Aussagen, die einen Herrschaftsanspruch des Menschen über die Natur begründen können.
Die Krise der Wälder und die Forstwirtschaft als Wiege der Nachhaltigkeit
 Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde
erstmals in der deutschen Forstwirtschaft des frühen
18. Jahrhunderts verwendet. Zu dieser Zeit waren die natürlichen
Wälder in Deutschland weitestgehend vernichtet. Den
ersten Schlag hatten ihnen ab etwa dem Jahr 1000 umfangreiche
Brandrodungen versetzt. Später hatte die Praxis der
Waldbeweidung das Nachwachsen neuer Bäume verhindert
und Landschaften hervorgebracht, die wir noch heute in
den Bildern der Romantiker bewundern. Schließlich
hatte die Frühindustrialisierung zu einer enormen
Zunahme des Holzbedarfes als Energieträger und Baustoff
geführt; um z.B. eine Tonne Eisen zu schmelzen wurden
50 m³ Brennholz benötigt, und auch Materialien
wie Salz oder Glas wurden unter hohem Energieaufwand gewonnen
(Dörfler/Dörfler, S. 14-16). Als Reaktion auf
dieses Dilemma setzte sich eine Forstwirtschaft durch,
bei der Wälder künstlich angepflanzt wurden und
bei der nicht mehr Holz geschlagen werden durfte als nachwächst.
Nachhaltig heißt hierbei, den Bestand (das „Kapital“)
zu erhalten und die „Zinsen“ zu nutzen (Kibbel/Müller
2002, S. 7). Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), Oberberghauptmann
in Kursachsen und damit ein Vertreter der Holz verbrauchenden
Montanwirtschaft, sprach in seiner Publikation „Sylvicultura
Oeconomica“ (1713) erstmals von einer nachhaltenden
Nutzung des Waldes (Wikipedia 2006). Auch Georg Ludwig
Hartig (1764-1837) hat sich um die Durchsetzung des Nachhaltigkeitsbegriffes
in der Forstwirtschaft verdient gemacht. Eine nachhaltige
Forstwirtschaft ist im Badischen Forstgesetz von 1831 verankert
(Kibbel/Müller 2002, S. 7).
Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde
erstmals in der deutschen Forstwirtschaft des frühen
18. Jahrhunderts verwendet. Zu dieser Zeit waren die natürlichen
Wälder in Deutschland weitestgehend vernichtet. Den
ersten Schlag hatten ihnen ab etwa dem Jahr 1000 umfangreiche
Brandrodungen versetzt. Später hatte die Praxis der
Waldbeweidung das Nachwachsen neuer Bäume verhindert
und Landschaften hervorgebracht, die wir noch heute in
den Bildern der Romantiker bewundern. Schließlich
hatte die Frühindustrialisierung zu einer enormen
Zunahme des Holzbedarfes als Energieträger und Baustoff
geführt; um z.B. eine Tonne Eisen zu schmelzen wurden
50 m³ Brennholz benötigt, und auch Materialien
wie Salz oder Glas wurden unter hohem Energieaufwand gewonnen
(Dörfler/Dörfler, S. 14-16). Als Reaktion auf
dieses Dilemma setzte sich eine Forstwirtschaft durch,
bei der Wälder künstlich angepflanzt wurden und
bei der nicht mehr Holz geschlagen werden durfte als nachwächst.
Nachhaltig heißt hierbei, den Bestand (das „Kapital“)
zu erhalten und die „Zinsen“ zu nutzen (Kibbel/Müller
2002, S. 7). Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), Oberberghauptmann
in Kursachsen und damit ein Vertreter der Holz verbrauchenden
Montanwirtschaft, sprach in seiner Publikation „Sylvicultura
Oeconomica“ (1713) erstmals von einer nachhaltenden
Nutzung des Waldes (Wikipedia 2006). Auch Georg Ludwig
Hartig (1764-1837) hat sich um die Durchsetzung des Nachhaltigkeitsbegriffes
in der Forstwirtschaft verdient gemacht. Eine nachhaltige
Forstwirtschaft ist im Badischen Forstgesetz von 1831 verankert
(Kibbel/Müller 2002, S. 7).
Alleine mit den Mitteln der Forstwirtschaft hätten die Wälder angesichts der fortschreitenden Industrialisierung allerdings nicht gerettet werden können; hierzu hat auch ganz wesentlich der Wechsel zur Kohle als dem (vorläufig) wichtigsten Energieträger beigetragen – u.a. mit den heute als Treibhauseffekt bekannten Folgen.
Bewegungen zum Schutz der Natur
Neben der Begründung der modernen Forstwirtschaft führte diese Misere der Wälder auch zur Entwicklung von Gegenbewegungen, welche die Natur bewahren und sie gezielter als bislang zum Gegenstand von Bildung und Erziehung machen wollten. Der Romantiker Ernst-Moritz Arndt (1769-1860) kritisierte 1815, "wie der heilloseste und ruchloseste Unfug mit edlen Bäumen und Wäldern getrieben ist und ganze Forsten ausgehauen und ganze Bezirke entblößt sind, weil der einzelne Besitzer mit der Natur auf das willkürlichste schalten und walten kann." Die ersten Verbände zum Schutz von Heimat, Natur und Umwelt gründeten sich, so im Jahr 1904 der Bund Heimatschutz (Bolscho/Seybold 1996, S. 22). Friedrich Fröbel (1782-1852) gründete Kindergärten, die er als „Gärten für Kinder“ verstand. Später entstanden „Landerziehungsheime“ (Krüger 1998). Die Ziele dieser Bewegungen schlugen sich auch in der Umweltbildung des 20. Jahrhunderts nieder. So wurden die bundesdeutschen Schulen 1953 dazu angehalten, ihren Blick auf „erzieherische und gemütsbildende Werte von Naturschutzbewegungen und Landschaftspflege“ zu richten (Kultusministerkonferenz 1953). Göpfert (1987) proklamierte die Konzeption der „naturnahen Bildung und Erziehung“; er wollte durch emotionale, sinnhafte, ganzheitliche Naturerfahrungen Liebe zur Natur erwecken und damit Grundlagen dafür schaffen, dass sich Menschen für deren Bewahrung einsetzen (siehe auch Bolscho/Seybold 1996, S. 85f). Die Naturpädagogik von Cornell (1991 a + b) kommt auch im 21. Jahrhundert zur Anwendung.
Globalisierung der Umweltprobleme im 20. Jahrhundert
Wurden bis zum frühen 20. Jahrhundert die ökologischen Auswirkungen der Industrialisierung noch überwiegend auf lokaler Ebene wahrgenommen, so wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend auch überregionale und globale Probleme erkannt. Der Verbrauch von endlichen Ressourcen wuchs weltweit exponentiell an, verbunden mit einer Zunahme des Abfallaufkommens sowie der Wasser- und Luftbelastungen. Zudem wurden konkrete Techniken als bedrohlich empfunden – allen voran, bereits seit den 50er Jahren, die „Atomtechnik“ (Kernspaltung). Publikationen wie „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et.al. 1973) oder in der Bundesrepublik Deutschland „Ein Planet wird geplündert“ (Gruhl 1975) verankerten diese Probleme im öffentlichen Bewusstsein.
Umweltbewegung als Protestbewegung
Das Aufleben der Umwelt- und Bürgerbewegung kann als Reaktion auf dieses Problembewusstsein verstanden werden (Bolscho/Seybold 1996). So gründeten sich bspw. in der Bundesrepublik 1972 der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), 1976 der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), 1979 die Bundespartei „Die Grünen“ und 1980 Greenpeace. Diese Bewegungen verstanden sich explizit als kritisch gegenüber der herrschenden Gesellschaft. Sie wollten einerseits vor der drohenden ökologischen Katastrophe warnen, postulierten jedoch auch gesellschaftspolitische Gegenentwürfe (beispielhaft siehe Gruhl 1975, S. 225ff). Diese Gesellschaftskritik fand u.a. in der Ökopädagogik ihren Niederschlag, die sich „gegen ökonomisch-technische Naturausbeutung“ und die diese stützenden „Denk- und Handlungsstrukturen“ wendete (Beer/de Haan 1984).
Umweltpolitik als Ordnungspolitik
Der Staat reagierte auf diese Probleme zunächst mit ordnungspolitischen Maßnahmen. Exemplarisch hierfür ist das Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 (Deutscher Bundestag 1972), das sich lediglich auf die Abfallbeseitigung konzentrierte, also auf die Strategie, Abfälle einzusammeln, sie zu wenigen vorgegebenen Plätzen zu verbringen und sie somit – scheinbar – ordentlich zu beseitigen.
Zur Stützung solcher staatlicher Strategien wurde an das Pflicht- und Ordnungsgefühl der Bürger appelliert. Der Umweltbildung wurde dabei eine funktionelle Rolle zugewiesen. Das Umweltprogramm der Bundesregierung von 1971 war nur umzusetzen, wenn „alle Gruppen und Kräfte unserer Gesellschaft“ es bejahen und mitwirken. „Das aber setzt Umweltbewußtsein bei jedem Bürger voraus...“ „Das zur Abwehr von Umweltgefahren notwendige Wissen muß in den Schul- und Hochschulunterricht sowie in die Erwachsenenbildung einbezogen werden. Umweltbewußtes Verhalten muß als allgemeines Bildungsziel in die Lehrpläne aller Bildungsstufen aufgenommen werden.“ (Die Bundesregierung 1971)
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die ordnungspolitischen Instrumente zu kurz griffen, z.B. als sich offiziell ausgewiesene Abfalldeponien in für die Umwelt und die Gesundheit von Bürgern bedrohliche Altlasten verwandelten (siehe Thiele 1992). Folgerichtig baute die Bundesregierung in den 80er Jahren ihr umweltpolitisches Instrumentarium aus und statuierte beispielsweise im Abfallgesetz von 1986 (Deutscher Bundestag 1986) erstmals ein Abfallverwertungsgebot. Zudem gerieten Berührungen zwischen bislang getrennt betrachteten Umweltmedien wie Abfall und Wasser (bei Klärschlamm bzw. Deponiesickerwasser) in den Blickpunkt.
Umweltbildung zwischen staatlicher Aufgabenzuteilung und Problem- und Handlungsorientierung
Damit erweiterte sich auch der Themenkatalog der umweltpolitisch motivierten Erziehung der Bürger erheblich. In vielen westdeutschen Städten entstanden kommunale Abfall- und Umweltberatungen, die z.B. Getrenntsammlung und Recycling oder den Verzicht auf Verpackungen propagierten (vgl. beispielhaft: Hoffmann/Müller 1992). Diesen Aktivitäten lagen teilweise naive Vorstellungen zugrunde, wonach Bildungsmaßnahmen zu einem veränderten (Umwelt-)Bewusstsein und dieses zu umweltgerechtem Handeln führen sollte (zur Kritik daran vgl. Bolscho 1997 und Preuss 1997). Auch in den Empfehlungen zu „Umwelt und Unterricht“ der Kultusministerkonferenz (1980) wird die Umweltbildung als Instrument umweltpolitischen Handelns angesehen.
Umweltpädagogen haben diese staatliche Aufgabenzuteilung und die damit implizierte individualistische Ausrichtung – also die Hoffnung, Umweltbewusstsein des Einzelnen könne die Umweltprobleme der Gesellschaft lösen – durchaus kritisiert (ausführlich in Wolf 2005, S. 92-101). Bolscho, Eulefeld, Seybold (1980, S. 16f) rückten die Erwartungen an die Umweltbildung zurecht. Demnach kann die Umweltbildung Probleme thematisieren, untersuchen, vergleichen, Fragen stellen, Antworten suchen und Denken und Handeln begleiten. Umweltbildung kann weniger Fakten feststellen und verbreiten als Menschen in den Prozess des Umgangs mit der Umwelt einbeziehen. Die Konzeption einer problem- und handlungsorientierten Umweltbildung will diese Kritik berücksichtigen. Umweltbildung soll nach Bolscho, Eulefeld, Seybold (1980, S. 17f) Schülern die Auseinandersetzung mit ihrer natürlichen, sozialen und gebauten Umwelt ermöglichen, die Fähigkeit zum Problemlösen in komplexen Systemen fördern und Schüler für die Beteiligung am politischen Leben befähigen.
Exkurs: Mensch-Umwelt-Beziehungen in der DDR
Wenn sich dieser Beitrag an den Verhältnissen in der Bundesrepublik orientiert, soll damit die Geschichte der DDR nicht negiert werden. Die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Verhältnisse führten hier zu ganz speziellen Umweltproblemen (Petschow/Meyerhoff/Thomasberger 1990), so z.B. zu einer hohen Luftbelastung mit Schwefeldioxid durch die Nutzung der einheimischen Braunkohle als wichtigstem Energieträger; dass die Braunkohle z.B. mit dem Karbid-Acetylen-Verfahren auch aus Ausgangsstoff für die chemische Industrie genutzt wurde, hatte weitere – allerdings regional begrenzte – Umweltbelastungen zur Folge.
In der DDR wurde, aufbauend auf dem Landeskulturgesetz (Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 1970) seit den 70er Jahren ein umweltrechtliches Regelwerk aufgebaut. Dieses sollte zwar einerseits den Umweltschutz im Sinne des Klassenkampfes instrumentalisieren (vgl. ebd., Präambel), andererseits aber reichte es z.B. mit dem speziellen Recyclingsystem zur Erfassung von „Sekundärrohstoffen“ (Ministerium für Materialwirtschaft 1986) bis in die Lebenswelt der Bürger.
Auch in der DDR entstand in den 70er und 80er Jahren eine Umweltbewegung, die sich vor allem in der Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU) des Kulturbundes der DDR sowie in kirchlichen Umweltgruppen organisierte (Wensierski 1985, Behrens et. al. 1993). Auch diese Umweltbewegung verstand sich als gesellschaftskritisch. Gesellschaftspolitische Gegenentwürfe (Bahro 1977) konnten allerdings, anders als in der Bundesrepublik, nicht im eigenen Lande publiziert oder gar praktiziert werden. Schon kleinere unabhängige Aktionen zum Umweltschutz weckten das Misstrauen und die Abwehr der Staatsorgane. Dennoch gelang es Umweltgruppen, ein Profil zu entwickeln, bei dem oftmals der Erwerb von Wissen, praktische Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz sowie kleine Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit Hand in Hand gingen (vgl. beispielhaft Kuhn 1996, Berg 1999, Krüger/Priebe o.J., SRU 1996, S. 226-230).
Integrative Instrumente der Umweltpolitik
In einer weiteren Entwicklungsphase – vor allem in den 90er Jahren – wurden neue umweltpolitische Analyse- und Steuerungsinstrumente geschaffen. Hierzu gehören das Öko-Audit (EG 1993 / EG 2001), die Ökosteuer (Nutzinger/Zahrnt 1989 sowie Umweltbundesamt 2002) oder das Contracting (Weizsäcker/Lovins/Lovins 1996, S. 180). Diese Instrumente orientieren auf das Machbare anstatt vor drohenden Katastrophen zu warnen, sie setzen auf eine Stärkung der Verursacher (insbesondere der gewerblichen Wirtschaft) anstatt auf Konfrontation, Agitation bzw. ordnungspolitische Regulierung. Sie sind von einer mehrere verschiedene Teilaspekte integrierenden Sichtweise geprägt. So dient z.B. das Öko-Audit der Stärkung des Umweltschutzes in Unternehmen, dabei werden alle jeweils relevanten Umweltauswirkungen einbezogen (neben den Abfällen z.B. auch die Rohstoffe / Materialien / Vorprodukte und deren Gewinnung sowie die Freisetzung von Abwasser, Abgasen oder Lärm). Bei der Produktlinienanalyse oder der Ökobilanz wird der gesamte Lebenszyklus eines Produkts – von der Gewinnung der Rohstoffe über die Nutzung bis zur Verwertung bzw. Entsorgung nach Gebrauch – analysiert.
Derartige Instrumente haben auch Einzug in die Umweltbildung bzw. Bildung für nachhaltige Entwicklung gefunden:
- Öko-Audit bzw. Nachhaltigkeitsaudit in Schulen
- Contracting und andere finanzielle Instrumente zum Umweltschutz in Schulen
Nachhaltigkeit als hoch integrative Sichtweise
Diese integrierende Sichtweise erreichte mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit einen vorläufigen Höhepunkt. Ausgangspunkt war einerseits die Erkenntnis, dass viele Umweltprobleme globalen Charakter angenommen haben und daher auch nur durch gemeinsames Engagement der internationalen Staatengemeinschaft zu lösen sind und andererseits die Einsicht, dass Umweltprobleme nicht zu Lasten der berechtigten Entwicklungsinteressen vor allem der Länder des Südens gelöst werden können. Demnach werden nicht nur einzelne Umweltprobleme in ihrer Vernetztheit gesehen, vielmehr sollen ökologische Probleme in Verbindung mit ökonomischen und sozialen Herausforderungen betrachtet und bewältigt werden.
Dieser kurze Abriss soll eine Vorstellung davon vermitteln, dass die Art und Weise, wie der Mensch über sein Wechselverhältnis mit der Umwelt nachdenkt – die Informationen, die er einbezieht, die Wertungen, Schlussfolgerungen, die er trifft – sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die Dynamik dieser Veränderungen nimmt gegenwärtig eher zu als ab, erkennbar z.B. an der „Halbwertszeit“ von politischen Verlautbarungen oder Umweltgesetzen. Was hier vorrangig am Beispiel der Material- und Abfallwirtschaft skizziert wurde, gilt auch für andere Bereiche der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Damit entwickeln sich nicht nur die Grundlagen der Umweltbildung permanent weiter, sondern neues Wissen, neue Sichtweisen, Instrumente, Technologien verändern die Weise, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht, was wieder neue Ausgangssituationen für die Reflexion der Mensch-Umwelt-Beziehungen schafft. Der Nachhaltigkeitsdiskurs reiht sich in diese Entwicklung ein, und es besteht kein Anlass zu der Vermutung, dass sie damit einen Abschluss findet.
- Agenda 21 und nachhaltige Entwicklung global
- nachhaltige Entwicklung in Deutschland
- Bildung für nachhaltige Entwicklung
Der Arbeitsbereich "Agenda 21 und Bildung für nachhaltige Entwicklung" auf umweltschulen.de entstand in Kooperation mit dem Fernstudiengang Umwelt&Bildung der Universität Rostock.