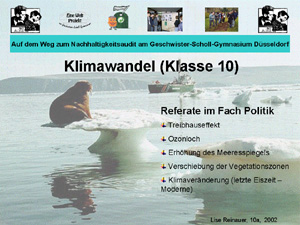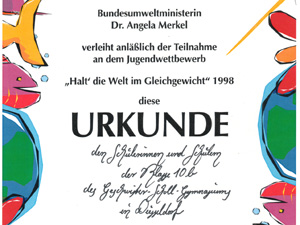Geschwister-Scholl-Gymnasium: Energie sparen und Klima
schützen
Energie und Klima in Jahrgangsstufe 10 (Leitfächer
Politik und Physik)
Ausgangssituation
Das Thema Energie und Klima haben wir den Fächern
Physik und Politik in Jahrgangsstufe 10 entsprechend den
Richtlinien unterrichtet. Die Unterrichtsgegenstände
sind
- im Fach Physik Energie: Satz von Erhaltung
der Energie, Energieträger, Energieumwandlung, Kernspaltung,
Atomenergie
- im Fach Politik der Treibhauseffekt:
Ursachen, globale Folgen, Prognosen, Gegenmaßnahmen,
Beschlüsse von Rio, Kyoto
Weitere Unterrichtsthemen waren die Teilnahme an schulischen
und bundesweiten Wettbewerben (Bundesumweltministerium, Bundeszentrale
für politische Bildung), Exkursionen zum Braunkohleabbaugebiet
am linken Niederrhein, Messungen über
die Leistung der Fotovoltaikanlage des Geschwister- Scholl-Gymnasiums,
ökonomische und ökologische Aspekte von Strom aus
Fotovoltaikanlagen, Untersuchungen über Energieeinsparmöglichkeiten
an der Schule sowie Plakate und Logos zum Energiesparen im
Rahmen des Fifty-Fifty-Programms der Stadt Düsseldorf.
Im Schuljahr 2001/02 wurde in diesem
Zusammenhang auch die Medienkompetenz der Schülerinnen
und Schüler gefördert.
Es wurden Internet- und Datenbankrecherchen (LexisNexis)
zum globalen Klimawandel durchgeführt, Excel-Grafiken
erstellt und Powerpoint-Präsentationen entwickelt. Die
Verbindung von theoretischer Einsicht und praktischem Handeln
führte 1999 zu einem Energierundgang mit dem Ingenieurbüro
Leclaire, zur getrennten Erfassung des Energieverbrauchs
am Geschwister-Scholl-Gymnasium sowie zur Installation von
Heizungsventilen in den Klassenräumen im Sommer 2001.
Im Herbst 2001 wurden durch einen Physik-Kurs Jahrgangsstufe
11 Temperaturmessungen in den Klassenräumen durchgeführt.
Durch die Feineinstellung konnte der Energieverbrauch reduziert
werden. Die Schule sparte 6,9% der Heizenergie ein und erhielt
dafür im Januar 2003 durch das 50:50-Projekt erstmalig
2.735 Euro.
Ziele
Im Schuljahr 2002/03 werden diese Ansätze genauer
aufeinander abgestimmt, um das vernetzte, fächerübergreifende
Denken und Handeln bei den Schülerinnen und Schülern
zu fördern. Dabei können die in den Projekten Müll
(Jahrgangsstufe 6) und Wasser(Jahrgangsstufe 8) erlernten
Kompetenzen inhaltlich und methodisch vertieft werden.
Insbesondere soll die Anwendung der in Jahrgangsstufe 8 erlernten
Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint, Internet) auf eigenständige
Recherchen in (nicht didaktisierten) Zeitungs-Datenbanken
ausgeweitet werden, womit im vergangenen Schuljahr bereits
mit Erfolg begonnen wurde. Am Ende soll eine Präsentation
der Ergebnisse erfolgen, wodurch die verschiedenen (mündlichen,
schriftlichen, künstlerischen, grafischen) Darstellungskompetenzen
der Schülerschaft gefördert werden.
Das Thema Licht, Energie, Klima kann auch in weiteren Fächern
(Kunst, Religion, Deutsch, Musik u.a.) behandelt werde, wodurch
sich Perspektiven für eine weitere überfachliche
Zusammenarbeit ergeben. Möglich wären z.B. eine
Kunstausstellung rund um das Thema Licht, Plakate oder Logos
zum Energiesparen, Untersuchungen und Darstellungen zur Bedeutung
des Lichts in den Religionen, in Literatur und Musik („heller“
Ton).
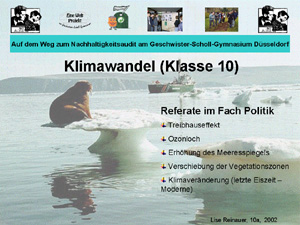 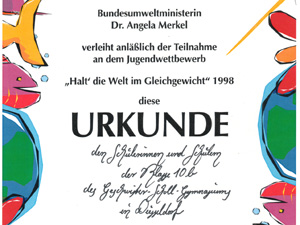
Folie aus der Präsentation „Klimawandel“ in
der Jahrgangsstufe 10 (2002 - links)
Urkunde über vom Bundeswettbewerb „Halt‘ die
Welt im Gleichgewicht“ 1998 (rechts)
Umsetzung im Schuljahr 2002/03
Die Themen werden wie bisher parallel in den Fächern
Physik und Politik bearbeitet. Im Mai/Juni finden Fachexkursionen
statt. Jede Klasse kann an 1 bis 2 Exkursion teilnehmen.
Exkursionsvorschläge:
- Braunkohletagebau (linker Niederrhein), Schachtanlage
zum Steinkohleabbau (Ruhrgebiet), Shell Solarfabrik (Gelsenkirchen),
Umstellung des Kohle- auf das Gaskraftwerk Lausward (Düsseldorf),
(stillgelegtes) AKW Mülheim-Kärlich, Solarpark
im Forschungszentrum Jülich
- Projekttag am Franz-Jürgens-Berufskolleg (Zeitbedarf:
4 Std.) Die Schule verfügt über einen Solar-Fachraum,
in dem Messungen zu verschiedensten Solaranwendungen durchgeführt
werden können. In dem Unterrichtsprojekt berechnet
die Schülerschaft, wie viel Energie und Geld erforderlich
ist, um an der Partnerschule in Somalia auch nach Sonnenuntergang
(18.00 Uhr !) Lesen oder Unterricht zu ermöglichen.
Die Schülerinnen und Schüler berechnen, welche
Lampen mit einem minimalen Verbrauch einen Arbeitstisch
optimal ausleuchten, welche Batterien umweltfreundlich,
langlebig und kostengünstig sind und wie teuer eine
Solaranlage insgesamt ist. Dazu stehen ihnen Arbeitsblätter,
Nachschlagewerke, Kataloge und der fachliche Rat der Physikkollegen
zur Verfügung.
- Besuch der 7. Düsseldorfer Solarwoche im Sommer
2003
- Besuch der Projektmesse „Mit Energie gewinnen“ der
Düsseldorfer Energiesparschulen
- Besuch der Fa. Gottschall (Lierenfeld): innovative Heiztechnik
(Solaranlagen, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Niedertemperaturanlagen,
Brennwerttechnik)
Weitere Unterrichtsideen:
- Leistung der Fotovoltaikanlagen: Analyse der Leistung
(Tages-, Monatskurven), Messung des Wirkungsgrads der Siemens-Solarzellen
am GSG, Vergleich mit anderen PV-Modulen
- Recherchen in der Datenbank des FIZ Karlsruhe (naturwissenschaftliche
Forschungsergebnisse) oder LexisNexis (Zeitungsdatenbank;
Themenrubrik
„Aus Naturwissenschaft und Technik“ u.a.)
- Elektronische Messung des Temperaturverlaufs eines Klassenraums
in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt Das Temperaturmessgerät
mit eingebautem
Datenlogger wird im Klassenraum installiert. Dabei kann
auch die Temperaturkurve der unterrichtsfreien Zeit exakt überprüft
und ggf. die Heizungsanlage optimiert werden. Außerdem
kann auch der Sauerstoff- und CO2-Gehalt des Unterrichtsraums
aufgezeichnet werden.
- Messungen zur Ausleuchtung der Klassenräume mit
einem Luxmeter
- Einspeisung des FV-Stroms am GSG, Verkauf des Stroms
an die Stadtwerke, Bildung von Finanzrücklagen für
Reparaturarbeiten o.Ä.
Klimasymposium – Ein Unterrichtsprojekt
im Fach Politik in Klasse 10
(Mai bis Juni 2002)
Die Klimaveränderungen und die drohende Klimakatastrophe
sind zurzeit allgegenwärtige und viel diskutierte Themen.
Im Politikunterricht unserer 10. Klasse mussten wir jedoch
feststellen, dass über die tatsächlichen Fakten
kaum Kenntnisse vorlagen, dass niemandem genaue Daten bekannt
waren und dass sehr unterschiedliche Ansichten herrschten.
Es hätte den Unterrichtsrahmen gesprengt, wenn sich
jede Schülerin und jeder Schüler über alle
Aspekte genau hätten informieren sollen. Das Thema „Klima“ ist
zu umfangreich und so beschlossen wir, ein Symposium zu veranstalten.
Kleine Gruppen oder einzelne Schülerinnen und Schüler
sollten sich für bestimmte Teilaspekte zu Experten machen.
Die verschiedenen Gebiete, die bearbeitet werden sollten,
waren unter anderen:
- Antrophogen verursachter Treibhauseffekt
- Ozonloch über der Antarktis und über Australien
- Abschmelzen der Polkappen
- Dürren in Ländern der 3. Welt
- Desertifikation
- Tornados
- Sintflut und heutige Flutkatastrophen
- Verschiebung der Vegetationszonen
- Klimaveränderungen in Deutschland
- Maßnahmen umweltverträglichen Wirtschaftens
- Klimapolitik der großen Industrienationen
Jede Gruppe musste zunächst Informationen sammeln.
Es stellte sich die Frage, woher umfangreiche und objektive
Daten bezogen werden konnten. Unsere Lehr- und Schulbücher
haben eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren und waren somit
für unsere Zwecke nicht mehr aktuell genug. Wir mussten
uns also auf die neuen Medien, besonders auf das Internet
stützen.
Über die Schule wurde uns für die Laufzeit des
Projektes der Zugang zur Datenbank LexisNexis gewährt
und so hatten wir Zugriff auf Zeitungsartikel der weltweit
wichtigsten Zeitungen. Wie diese Ressource genutzt werden
kann, lernten wir – ganz nebenbei – an den schuleigenen
Rechnern im Computerraum. Weiterhin recherchierten wir zu
Hause über die weiteren Suchmaschinen im Internet sowie
in den Archiven der Unibibliothek. Die Erkenntnisse und Daten
sollten von den Expertengruppen als Powerpoint-Präsentationen
ansprechend aufbereitet werden. Das war für den Unterricht
relativ neu, doch sinnvoll zu erlernen, denn auf dieses Wissen
können wir nun auch für Referate in anderen Fächern
zurückgreifen. Die Vorteile dieser Art des Vortrags
wurden schnell offensichtlich: Gerade bei einem Thema wie
diesem, bei dem mit vielen schwierig zu begreifenden Daten
und vorwiegend mit Zahlen und Prozentpunkten hantiert werden
muss, sind Grafiken und Tabellen zur Veranschaulichung der
Ergebnisse sinnvoll. Durch die Folien ist eine bessere Gliederung
möglich und die Zuhörer können dem Vortrag –
da sich ein Bild jeweils aufbaut – besser folgen.
Uns ist klar geworden, dass objektive Daten in ausreichendem
Umfang auf diesem Gebiet immer noch nicht existieren und
dass sich die Messungen und Prognosen der einzelnen großen
Institute immens unterscheiden. Es besteht weiterhin großer
Forschungsbedarf. Nach der intensiven Beschäftigung
mit diesem Thema haben wir erkannt, dass sich einzelne Organisationen – vor
allem Politiker und Umweltverbände –
auf wenige Informationen beschränken, und daraus nicht
ausreichend gesicherte Schlüsse ziehen, die ihren jeweiligen
politischen Intentionen entsprechen.
Nachdem die Informationen auf dem Symposium an alle Mitschülerinnen
und Mitschüler weiter gegeben wurden, können wir
diese Thematik im Unterricht nun viel kompetenter diskutieren.
Wir werden die Kyoto-Verhandlungen in Zukunft kritischer
verfolgen und auch im Bereich unserer Schule und Umwelt klimaschonende
Projekte aufmerksamer wahrnehmen und unterstützen.
Theodor Wahl-Aust
|