Energie und nachhaltige Entwicklung
|
Gliederung dieser Seite |
|
|
Ein Rückblick
Bis ins 18. Jahrhundert hinein war die Menschheit bei der Verrichtung ihrer Arbeiten vor allem auf die Muskelenergie von Mensch und Tier angewiesen, ergänzt wurde diese durch die Nutzung der Energie von Wind und Wasser. Das Feuer wurde nur zur Wärmegewinnung genutzt. Energie stellte eine knappe Ressource dar, die das Wirtschaften der Menschheit existenziell begrenzte.
Erst die Erfindung der Dampfmaschine läutete die industrielle Revolution ein. Die Dampfmaschine und weitere grandiose technische Erfindungen wie Generator und Elektromotor, Verbrennungsmotoren und Kernspaltungsreaktor öffneten der Menschheit völlig neue Horizonte. Sie ermöglichten es, Kohle, Erdgas, Erdöl und Uran zur Energiegewinnung zu nutzen. Nun wurde es z.B. möglich, die Landwirtschaft zu mechanisieren und somit Arbeitskräfte für die Industrie freizusetzen. Die gesamte industrielle Warenproduktion und unser Transportsystem basieren auf diesen fossilen Energieträgern.
Grenzen der klassischen Energiewirtschaft
Etwa 200 Jahre lang war die Energiewirtschaft vor allem darauf ausgerichtet, ständig mehr Energie für ständig wachsende Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Allmählich setzt sich jedoch die Erkenntnis durch, dass diese strategische Ausrichtung der Energiewirtschaft auf neue, ebenfalls existenzielle Grenzen stößt:
- Kohle, Öl und Erdgas sind in geo-bio-chemischen Prozessen entstanden, die Millionen von Jahren dauerten. Wir Menschen verbrauchen diese Energieträger jetzt in einem Zeitraum, der aus erdgeschichtlicher Perspektive nur als kurzer Augenblick bezeichnet werden kann. In absehbarer Zeit werden diese Ressourcen, ebenso wie die nutzbaren Vorräte an Uran, erschöpft sein. Für den Rohstoff Erdöl wird - bei aller Unsicherheit, die in solchen Aussagen liegt - davor gewarnt, dass spätestens 2020 die Förderspitze erreicht ist, d.h. für die Zukunft sind nur noch eine Verknappung des Öls, weiter steigende Preise und zunehmende politische (militärische?) Konflikte um diesen knappen Rohstoff zu erwarten. Jeremy Leggett geht in seinem Buch "Peak Oil" sogar davon aus, dass diese Förderspitze bereits 2006 erreicht worden ist.
- Die Reaktionsprodukte der Verbrennungsprozesse belasten die Umwelt. Es ist zwar gelungen, recht wirksame Maßnahmen gegen den Ausstoß saurer Gase (Schwefel- und Stickoxide) zu finden. Nach wie vor entsteht bei der Verbrennung fossiler Energieträger jedoch Kohlendioxid, welches den größten Teil des anthropogenen Treibhauseffekts verursacht. Aus Gründen des Klimaschutzes können wir es uns überhaupt nicht leisten, die globalen Vorräte der fossilem Kohlenstoffträger komplett auszubeuten - das betrifft insbesondere die Braunkohle und die Steinkohle, von deren noch relativ reichliche Vorräte vorhanden sind (siehe Klimaschutz).
- Auch Kernenergie ist nicht zukunftsfähig. Sie spielt eine gesonderte Rolle, denn beim Betrieb von Kernreaktoren wird kein Kohlendioxid freigesetzt. Dafür aber wird hier mit radioaktiven bzw. derart toxischen Stoffen gearbeitet, dass die Kernenergie nur bei 100prozentiger Fehlerfreiheit – von der Gewinnung der Ausgangsstoffe bis zur Endlagerung – akzeptabel sein könnte. Es widerspricht jedoch der Erfahrung, dass so komplexe Mensch-Maschine-Systeme absolut fehlerfrei arbeiten. Hinzu kommt, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie eng mit der militärischen (und potenziell auch mit der terroristischen) Nutzung verbunden ist: Wer Kernspaltungsreaktoren betreibt, kann auch das spaltbare Material für Atombomben herstellen. Die internationalen Konflikte um die Atomprogramme des Iraks oder Nordkoreas haben diese Problematik verdeutlicht.
- Die Auswirkungen der Arbeit, die wir mit der technisch bereitgestellten Energie betreiben, sind längst nicht nur segensreich. In einem sehr energieaufwendigen Prozess wird z.B. der in der Luft enthaltenen Stickstoff in Nitratdünger umgewandelt. Dieser hat einerseits dazu beigetragen, die Erträge im Ackerbau zu erhöhen, andererseits bedrohen Nitrate bei übertriebener Düngung das Grundwasser, also unsere wichtigste Trinkwasserquelle.
-
 Die
Inanspruchnahme von Energie ist auf unserem Planeten extrem
ungerecht verteilt. Die weniger als 20% der Menschheit
in den Industrieländern
verbrauchen 70% der weltweit genutzten Energie. Diese Ungerechtigkeit
kann und darf wegen der oben genannten Grenzen nicht dadurch
beseitigt werden, dass die Entwicklungsländer ihren Energiekonsum
auf das Maß der Industrieländer anheben. Zudem
profitieren vorrangig internationale Unternehmen sowie die
nationalen Führungseliten
an der Gewinnung von Bodenschätzen, während Umweltverschmutzung
zu Lasten der regionalen Bevölkerung geht.
Die
Inanspruchnahme von Energie ist auf unserem Planeten extrem
ungerecht verteilt. Die weniger als 20% der Menschheit
in den Industrieländern
verbrauchen 70% der weltweit genutzten Energie. Diese Ungerechtigkeit
kann und darf wegen der oben genannten Grenzen nicht dadurch
beseitigt werden, dass die Entwicklungsländer ihren Energiekonsum
auf das Maß der Industrieländer anheben. Zudem
profitieren vorrangig internationale Unternehmen sowie die
nationalen Führungseliten
an der Gewinnung von Bodenschätzen, während Umweltverschmutzung
zu Lasten der regionalen Bevölkerung geht.
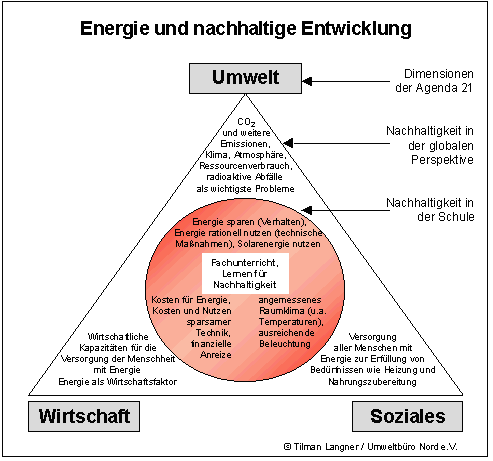
Herausforderungen einer zukunftsfähigen Energiewirtschaft
Wir stehen daher vor der Herausforderung, die Nutzung von Energie grundlegend neu zu ordnen.
- Die Effizienz der Energieumwandlung – d.h. das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand – kann noch deutlich erhöht werden. Niedrigenergiehäuser, Brennwertheizungen oder das Drei-Liter-Auto sind bekannte Beispiele - es gilt, solche effizienten Techniken nicht nur zu entwickeln, sondern diese Erfindungen auch in der alltäglichen Praxis anzuwenden.
- Wir Menschen in den Industrieländern müssen unseren Energiekonsum verringern. Diese als Suffizienz bezeichnete Strategie berührt unseren Lebensstil und ist daher besonders schwer umzusetzen. Ist sie deswegen utopisch? Es tut kaum weh, ein Haus bedarfsgerecht zu beheizen, anstatt Tag und Nacht alle Räume auf 23°C zu temperieren. Wer aber möchte seine Autofahrten deutlich reduzieren?
-
 Der
für ein effizientes und suffizientes Wirtschaften dann noch
erforderliche Energiebedarf kann weitgehend aus erneuerbaren
Energien – Sonne, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme
– gedeckt werden. Die Nutzung dieser Energieträger
gilt es heute auszubauen!
Der
für ein effizientes und suffizientes Wirtschaften dann noch
erforderliche Energiebedarf kann weitgehend aus erneuerbaren
Energien – Sonne, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme
– gedeckt werden. Die Nutzung dieser Energieträger
gilt es heute auszubauen! - Der Zugriff auf die Energieträger muss weltweit
gerecht verteilt werden. Technik
und Know-how zur Nutzung der regenerativen Energien müssen weltweit
zu fairen Preisen verfügbar gemacht werden.
Energie in der Schule
Es ist wenig aussichtsreich, Schülern die oben skizzierten umweltpolitischen Forderungen "beizubringen" und dann darauf zu hoffen, dass sie sich künftig umweltgerechter verhalten würden. Der Umbau der Energiewirtschaft (als Teil einer nachhaltigen Entwicklung) wird ähnlich gravierend sein wie die Veränderungen der industriellen Revolution - und das ist nicht mit Agitation zu lösen, und das kann auch nicht alleine den kleinen Energieverbrauchern angelastet werden. Der Umbau der Energiewirtschaft ist aber mit vielfältigen Fragen verbunden, die Sie im Unterricht sinnvoll aufgreifen können:
 Noch für Jahrzehnte gibt es hier spannende technische Herausforderungen
zu meistern. Welche Berufsbilder sind zukunftsfähig und welche
Kompetenzen sind da gefragt?
Noch für Jahrzehnte gibt es hier spannende technische Herausforderungen
zu meistern. Welche Berufsbilder sind zukunftsfähig und welche
Kompetenzen sind da gefragt?
Zudem werden der Gesellschaft und jedem einzelnen Menschen ethisch wertende Entscheidungen abverlangt. Die o.g. umweltpolitischen Forderungen sind nur für den relevant, der im Sinne des Nachhaltigkeitsleitbildes auch künftigen Generationen sowie den Menschen in anderen Teilen der Welt gleiche Chancen einräumt wie er selbst beansprucht. Wer nur an heute denkt, hat kein Energie-, sondern bestenfalls ein Kostenproblem. Wie aber enstehen Werte? Welche Vorstellungen haben die Schüler von einem gelingenden Leben, welche Rolle spielt dabei eine intakte Umwelt?
Nicht nur mangelnde Einsicht, sondern auch überkommene Strukturen (in Wirtschaft und Politik) stehen einer nachhaltigen Entwicklung entgegen. Welche Kräfte und welche Mechanismen wirken hier? Welche ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden? Und wie kann sich der Einzelne gegenüber den scheinbar übermächtigen Gesetzten von Politik und Weltwirtschaft positionieren?
Diese Fragen zeigen ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Themenbereich "Energie" auf. Das Material, das Sie hier auf dem Server umweltschulen.de finden, bildet nicht diese ganze Breite des Themas ab. Entsprechend meinen eigenen Erfahrungen konzentriere ich mich auf die folgenden Aspekte:
- Die Energiewende als technische Herausforderung: Solar- oder Windenergie ist längst nicht mehr verstaubter "Ökokram", sondern "sexy" Hightech. Schüler können z.B. Solarkocher selbst bauen, eine eigene Solaranlage auf der Schule installieren oder sich dafür einsetzen, dass ihre Schule mit Ökostrom versorgt wird. (Auch wenn das nicht im Mittelpunkt der Lehreinheiten steht, können die Schüler hier auch mit zukunftsfähigen Berufsbildern in Kontakt kommen; vertiefen Sie diesen Aspekt nach Möglichkeit über das hier angebotene Material hinaus.)
- Die Energiewirtschaft der eigenen Schule: Die eigene Schule ist ein Raum, in dem die Schüler Energiewirtschaft "begreifen" und auch folgenreich in sie eingreifen können. Sie spüren es am eigenen Leibe, wenn Räume ungeschickt beheizt oder Arbeitsplätze schlecht beleuchtet werden. Schüler und Lehrer können schon mit einfachen Mitteln die Energiewirtschaft der Schule bewerten und optimieren. Sie können damit oft gleichzeitig den Lebenswert der Schule erhöhen, die Umwelt entlasten und Geld einsparen. Wenn man Erfahrungen aus Modellprojekten hochrechnet, dann könnten die Schulen in Deutschland durch intelligentes Nutzerverhalten jedes Jahr insgesamt 3,6 Milliarden kWh Energie und damit 200 Mio Euro Energiekosten einsparen (Schmidthals 2008). Viele Schulträger bieten den Schulen als Anreiz zum Energiesparen einen Teil dieses eingesparten Geldes zur freien Verwendung an - hier kommen leicht einige tausend Euro pro Jahr zusammen, die dann z.B. in Maßnahmen investiert werden können, welche die Attraktivität der Schule erhöhen.
- Klimaschutz: Klimaschutz ist eine der grundlegenden umweltpolitischen Herausforderungen der Menschheit an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Wenn Schulen in dem oben genannten Umfang Energie einsparen würden, würden sie damit "nebenbei" auch 1 Mio t CO2-Ausstoß einsparen. Im Rahmen der Kampagne "Klimadetektive" können Sekundarschüler sich mit dieser Herausforderung vertraut machen und in verschiedenen Bereichen des Schulbetriebs zum Klimaschutz beitragen.
Daneben versuche ich, auch aktuelle umweltpolitische Hintergrundinformationen mit zu integrieren, so dass Lehrkonzepte, Aktionsvorschläge und Hintergründe für Sie nur einen Mausklick voneinander entfernt sind.
Quellen
-
Leggett, Jeremy (2006): Peak Oil. Köln: Kiepheuer & Witsch
(Englisches Original: Leggett, Jeremy, 2005: Half gone. Portobello Books Ltd.) - Schmidthals, Malte(2008): Energiesparen an Schulen in Deutschland: Stand, Erfolgskriterien und Potenziale. In: Bundesverband Schule Energie Bildung e.V.: Tagungsband Energiesparmesse für Schulen; S. 5-10
- Umweltbundesamt (2007): Klimaänderungen, deren Auswirkungen
und was für den Klimaschutz zu tun ist. (Dieses Dokument ist
eine allgemeinverständliche Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse
aus dem vierten IPCC Klimabericht.) Online-Dokument, URL: www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/hintergrund/ipccsynthese.pdf,
Dokument offline
(Englisches Original: www.ipcc.ch/)
Förderer und Partner der Klimadetektive


